Eine […] social literacy wäre der wichtigste Baustein einer Strategie gegen die Ausbreitung von Verschwörungstheorien, sie sollte aber unbedingt ergänzt werden durch zwei Aspekte, die ich als ‚Medienkompetenz‘ oder media literacy und ‚Geschichtskompetenz‘ oder historical literacy bezeichnen würde.
Butter 2018: 229
Warum wir Verschwörungserzählungen im Geschichtsunterricht thematisieren sollten
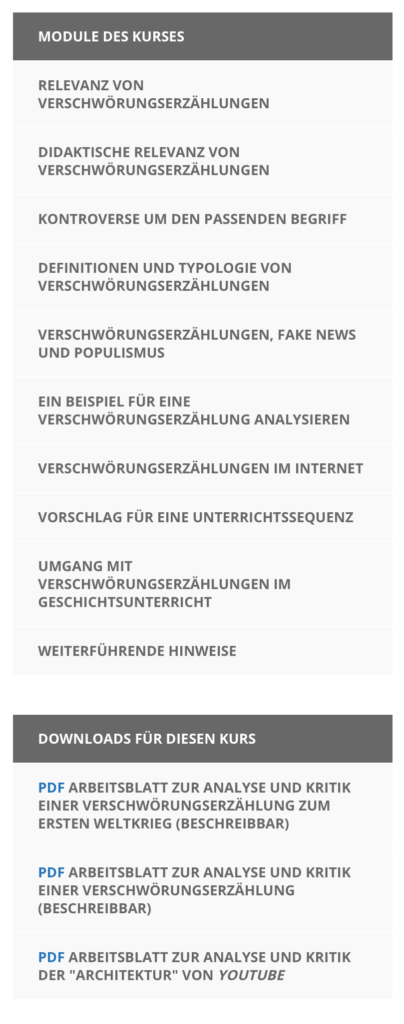
Verschwörungserzählungen sind nicht nur, aber vor allem ein Krisenphänomen. Sie kommen und gehen wie Krisen kommen und gehen – mag man meinen. So einfach ist es aber nicht: es hat sie immer gegeben und es wird sie vielleicht auch immer geben, die Frage ist nur: Warum und wie sollten sich unsere Schülerinnen und Schüler mit ihnen im Geschichtsunterricht auseinandersetzen?
In diesem Beitrag – übrigens ein Ausschnitt aus meinem neuen Kurs in der Akademie | Geschichte 21 – stelle ich dir einige Gründe vor, warum wir Verschwörungserzählungen im Geschichtsunterricht thematisieren sollten.
Wenn du weiteres Interesse hast, dann sichere dir den Zugang zu meiner Akademie | Geschichte 21! Dort gehen wir u. a. konkret auf ein Beispiel für deinen Geschichtsunterricht, auf Verschwörungstheorien im Internet sowie den Umgang mit Verschwörungstheorien in deiner Lerngruppe ein. Im Video unten stelle ich dir den Kurs vor.

Sichere dir das kostenfreie Arbeitsblatt zum Umgang mit Verschwörungserzählungen: Erhalte die ausfüllbare PDF-Datei aus der Akademie | Geschichte 21 und nutze sie für deine unterrichtlichen Zwecke!
Kurs zu Verschwörungserzählungen in der Akademie | Geschichte 21
Wenn du meine Akademie | Geschichte 21 noch nicht kennen solltest, schau dir im Video unten kurz an, was dich in dem Kurs erwartet.
Verschwörungstheorien – im Geschichtsunterricht?!
Selbstverständlich lassen sich Verschwörungserzählungen auch in anderen Fächern thematisieren, etwa in Politik, Sozialwissenschaften, Deutsch oder Psychologie.
Die Thematisierung von Verschwörungserzählungen im Geschichtsunterricht jedoch birgt zum einen ein hohes Maß an didaktischem Potenzial für das historische Lernen. Zum anderen eignet sich der Geschichtsunterricht insbesondere für die Auseinandersetzung mit Verschwörungserzählungen.
Angesichts der Gefahr, die von einer unreflektierten Verbreitung von Verschwörungserzählungen für den Einzelnen, für die Gesellschaft und das politische System bzw. die Demokratie ausgehen kann, kommt der Amerikanist Michael Butter zum Schluss, dass wir schon in der Schule „social literacy“, „media literacy“ und „Geschichtskompetenz“ bzw. „historical literacy“ (Butter 2018: 229) fördern sollten. Denn, so schreibt er:
Meine These ist, dass Menschen, die mit Erkenntnissen der modernen Sozial- und Kulturwissenschaften oder der Psychologie vertraut sind, weniger zu Verschwörungstheorien neigen als diejenigen, die über diese Disziplinen nicht so viel wissen und daher implizit oder explizit noch einem altmodischen Verständnis von menschlicher Handlungsfähigkeit und gesellschaftlichen Prozessen anhängen.
Butter 2018: 229
Medienkompetenz, „social literacy“ und Geschichtskompetenz ohnehin lassen sich im Geschichtsunterricht fördern.

Medienkompetenz im Geschichtsunterricht fördern
Vor allem angesichts der Gefahren, die von Verschwörungserzählungen im Internet ausgehen können, ist es unerlässlich, dass sich die Schülerinnen und Schüler im Geschichtsunterricht auch mit Darstellungen und deren Funktionen in digitalen Medien kritisch auseinandersetzen.
Ähnlich wie mit anderen Beispielen aus der digitalen Geschichtskultur können Schülerinnen und Schüler durch die Analyse von Darstellungen und deren Funktionen, z. B. auf YouTube, lernen seriöse von nicht-seriösen Angeboten zu unterscheiden. Selbst wenn die Funktionsweisen von Algorithmen von den Anbietern (noch) nicht transparent gemacht werden, können unsere Schülerinnen und Schüler anhand von Internetrecherchen doch die Funktionsweise und das Wirkungspotenzial von sogenannten „Empfehlungsalgorithmen“ in Ansätzen analysieren und sie kritisch beurteilen.
In diesem Zusammenhang können unsere Schülerinnen und Schüler erkennen, dass Google-Einträge oder Videovorschläge auf YouTube weder „die Realität“ noch die Kontroversität von Themen widerspiegeln. Stattdessen können sie erkennen, dass auf der Basis persönlicher Präferenzen bzw. Sucheinträge, vermittelt durch Algorithmen, „Echokammern“ erzeugt werden, somit parallele Teilöffentlichkeiten entstehen können, die sich u. U. zunehmend weiter radikalisieren, wie es z. B. Pia Lamberty und Katharina Nocun in ihrem Buch Fake Facts. Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen zeigen (vgl. Lamberty und Nocun 2020: 123-152).

Sichere dir das kostenfreie Arbeitsblatt zum Umgang mit Verschwörungserzählungen: Erhalte die ausfüllbare PDF-Datei aus der Akademie | Geschichte 21 und nutze sie für deine unterrichtlichen Zwecke!
„Geschichtskompetenz“ fördern
Letztlich geht es jedoch nicht nur darum, unseren Schülerinnen und Schülern methodische Kompetenzen im Umgang mit Verschwörungserzählungen im Internet zu vermitteln. Vielmehr geht es auch darum, sie zu befähigen, begründete sachliche Urteile fällen zu können, damit sie souverän, kritisch und selbstbewusst mit Verschwörungserzählungen und ihren möglichen Gefahren umzugehen lernen.
Obwohl in unserem Falle nicht die Gefahr von einer politischen oder ideologischen Indoktrination der Lehrerin oder des Lehrers ausgeht, sondern sie stattdessen aus der außerschulischen Lebenswelt heraus generiert werden könnte, so hängt die Thematisierung von Verschwörungserzählungen doch eng mit dem Beutelsbacher Konsens zusammen.
Denn mittels einer Thematisierung von Verschwörungserzählungen wirken wir zumindest der außerschulischen „Überwältigung“ und „Indoktrination“ entgegen, fördern die „‚Gewinnung eines selbstständigen Urteils'“ und verfolgen die „Zielvorstellung von der Mündigkeit des Schülers [sic]“ (Bundeszentrale für politische Bildung 2011).
In unserem Geschichtsunterricht können Verschwörungserzählungen insofern das historische Denken und Urteilen fördern, als dass durch den analytisch-kritischen Umgang mit ihnen zentrale Merkmale der Quelleninterpretation eingeübt werden können:
- Formale Angaben zur Quelle machen: Insbesondere im Umgang mit Verschwörungserzählungen sind formale Angaben zur Quelle oder Darstellung bedeutsam und der Kritik dienlich: Wer ist der Verfasser oder die Verfasserin? Was muss ich über den „Autor“ bzw. die „Autorin“ wissen? Welche Intention verfolgt er oder sie? Wo wurde die Erzählung veröffentlicht? Handelt es sich um ein seriöses Publikationsorgan?
- Urteilsbildung: Verschwörungserzählungen fordern aufgrund ihrer provokanten und provozierenden Aussagen geradezu dazu heraus, sich kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen. Viele Aspekte des wissenschaftlichen Arbeitens müssen berücksichtigt und können gefördert werden, z. B. das sogenannte „debunking“, d. h. die genaue Quellenanalyse mit „Faktencheck“ bzw. die Recherche zu verlässlichen Quellen und Darstellungen für einen Vergleich mit den Aussagen der Verschwörungserzählung.
- Haltungen ausbilden: Letztlich kann eine erfolgreiche kritische Auseinandersetzung mit Verschwörungserzählungen die Ausbildung einer Haltung fördern, die mit den Werten unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und wissenschaftlich orientierten Gesellschaft nicht in Konflikt steht.
Last, but not least bringt die Auseinandersetzung mit Verschwörungserzählungen im Geschichtsunterricht zum einen den sehr bedeutenden Vorteil mit sich, dass wir es mit Erzählungen aus der Vergangenheit zu tun haben. Somit können sich unsere Schülerinnen und Schüler auch inhaltlich und emotional distanzierter mit den Erzählungen auseinandersetzen.
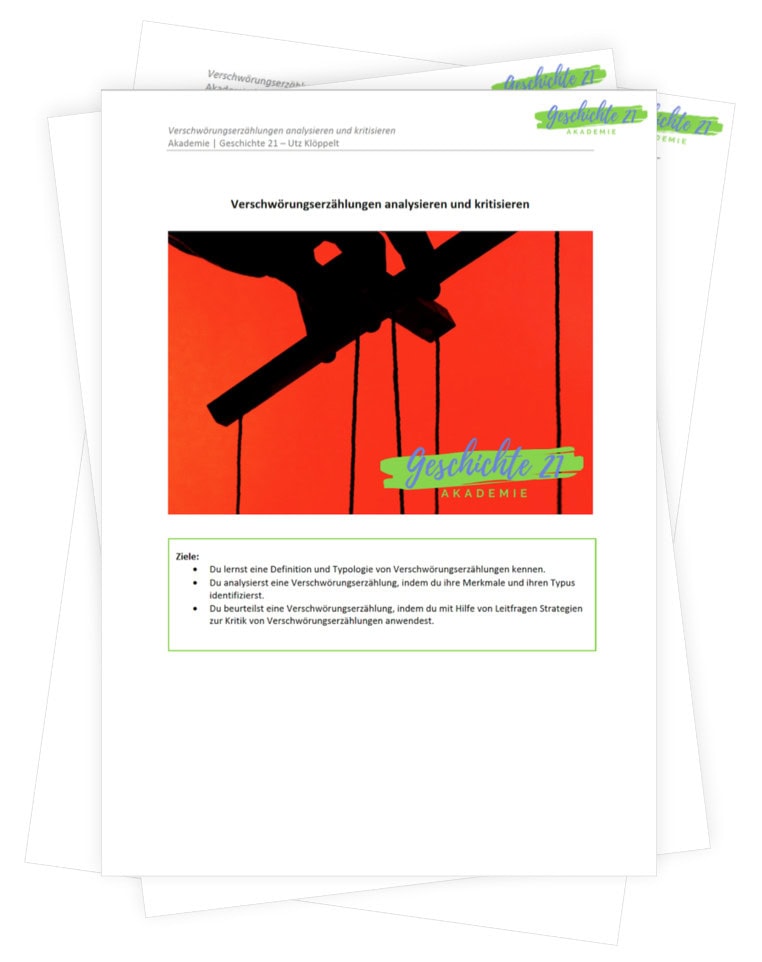
Denn bei einer Thematisierung gegenwärtig verbreiteter Verschwörungserzählungen, wie z. B. bei derjenigen zur vermeintlichen Rolle von Bill Gates oder der Bundesregierung während der durch COVID-19 bedingten Krise, kann es vorkommen, dass unsere Schülerinnen und Schüler emotional betroffen sind, etwa weil Verschwörungstheorien auch von Familienangehörigen, Freundinnen oder Freunden und Bekannten propagiert und verbreitet werden.
Zum anderen kann ein Blick in die Vergangenheit zu einer gewissen Gelassenheit führen: die meisten Verschwörungserzählungen erweisen sich im Rückspiegel einfach nicht als wahr. Auch wenn Verschwörungstheoretiker z. B. gerne auf die Watergate-Affäre verweisen, die von Verschwörungserzählungen flankiert war, die sich letztlich in Teilen als treffend herausstellten, bleibt dies doch die Ausnahme.
Selbst wenn es Verschwörungen immer gegeben hat und es sie vielleicht auch immer geben wird, unterscheiden sich die Erzählungen, die sich darum ranken, doch von tatsächlichen Verschwörungen:
Verschwörungen hat es immer gegeben und es wird sie immer geben, doch […] unterscheiden sich die historisch belegten Fälle, was Umfang, Reichweite und die Effektivität der Verschwörer angeht, signifikant von den Annahmen der Verschwörungstheoretiker darüber, wie Komplotte funktionieren und was sie erreichen können. Das an Beispielen zu vermitteln, wäre wichtig. Geschichtskompetenz ginge an dieser Stelle dann in Gesellschaftskompetenz über.
Butter 2018: 230

Sichere dir das kostenfreie Arbeitsblatt zum Umgang mit Verschwörungserzählungen: Erhalte die ausfüllbare PDF-Datei aus der Akademie | Geschichte 21 und nutze sie für deine unterrichtlichen Zwecke!
Ja, mach nur einen Plan,
Bertolt Brecht in der Dreigroschenoper, 1928
sei nur ein großes Licht!
Und mach dann noch ’nen zweiten Plan,
gehn tun sie beide nicht.
[…]
Meines Erachtens ist die Förderung der „social literacy“ eine Zielsetzung, die wir im Geschichtsunterricht vermehrt und bewusster verfolgen sollten.
Was ist mit „social literacy“ gemeint? Vor allem verbirgt sich hinter dem Ausdruck die Kompetenz, die Erkenntnisse der modernen Sozialwissenschaften auf historische oder gegenwärtige Phänomene anzuwenden.
Wenn wir etwa das Leben in einer griechischen Polis mit dem Leben heute vergleichen, dann wird besonders deutlich, dass wir heute in komplexeren sozialen, wirtschaftlichen und politischen Systemen leben und handeln.
Hier sei nur kurz darauf eingegangen: Die moderne Sozialwissenschaft ist selbstverständlich im Kontext komplexer Sozialsysteme entstanden. Ich gebe hier nur zwei Beispiele von Erkenntnissen der modernen Sozialwissenschaft, die bedeutsam für die Auseinandersetzung mit Verschwörungserzählungen und die Ausbildung einer „social literacy“ sind. Dazu komme ich nochmals auf den Amerikanisten und Experten von Verschwörungstheorien Michael Butter zurück, der zu diesem Thema schreibt:
Verschwörungen [gehen] von einem falschen Menschen- und Geschichtsbild aus, wenn sie behaupten, dass Geschichte über einen längeren Zeitraum plan- und kontrollierbar sei.
Butter 2018: 22
Die Grundannahmen von Verschwörungstheoretikern sind jedoch nicht nur einem veralteten Geschichtsbild, sondern auch einem veralteten Menschenbild verhaftet. Denn implizit berücksichtigen sie einerseits nicht die Erkenntnis der modernen Psychologie seit Freud, dass Menschen nicht (immer) Herr ihrer selbst sind, d. h. bisweilen gar nicht wissen, was sie wollen, geschweige denn ihre Absichten auch gezielt und erfolgreich in die Tat umsetzen könnten.
Hier kommt des Weiteren die moderne Sozialwissenschaft seit Max Weber mit der Erkenntnis ins Spiel, dass wir nicht immer die rationalen Akteure sind, für die Verschwörungstheoretiker die vermeintlichen Verschwörer oft halten. Nicht nur gehen unsere Handlungen oft auf irrationale Beweggründe zurück. Sie haben zudem auch oft unbeabsichtigte Nebenfolgen. Getreu dem Motto aus Bertolt Brechts „Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens“ (III. Akt aus Die Dreigroschenoper, Brecht 1928), aus dem ich oben zitiert habe, gehen die (geheimen) Pläne oft gar nicht auf – so wie Verschwörungserzählungen es aber oft unterstellen.
Der Philosoph Karl R. Popper gesteht in diesem Zusammenhang zwar ein, dass „die Struktur unserer sozialen Umgebung in einem gewissen Sinn von Menschen geschaffen ist“, auch dass unsere Institutionen „das Ergebnis menschlicher Handlungen und Entschlüsse“ (Popper 1945/1992) sind, die durch sie auch wieder verändert werden könnten, doch dies sei weitaus nicht immer so:
Im Gegenteil: Sogar jene Institutionen und Traditionen, die als das Ergebnis bewußter und absichtlicher menschlicher Handlungen entstehen, sind in der Regel das indirekte, unbeabsichtigte und oft unerwünschte Nebenprodukt solcher Handlungen. (Hervorhebung im Original)
Popper 1945/1992: 110
Zusammengefasst gesagt: Verschwörungserzählungen gehen eher von einem unpassenden, einfachen und naiven Menschen- und Geschichtsbild aus: weder der Mensch kann den Lauf der Dinge so planen, wie es die Erzählungen zumeist suggerieren, noch verläuft die Geschichte nach einem (geheimen) Plan.

Sichere dir das kostenfreie Arbeitsblatt zum Umgang mit Verschwörungserzählungen: Erhalte die ausfüllbare PDF-Datei aus der Akademie | Geschichte 21 und nutze sie für deine unterrichtlichen Zwecke!
Zum Weiterlesen
- Bertolt Brecht (1928). Die Dreigroschenoper, Berlin: Felix Bloch Erben.
- Bundeszentrale für politische Bildung (BpB; 2011). „Beutelsbacher Konsens“, auf: Die bpb. Wie arbeiten wir?, Eintrag vom 07.04.2011, URL: https://www.bpb.de/die-bpb/51310/beutelsbacher-konsens (Zuletzt aufgerufen: 24.06.2020).
- Michael Butter (2018). „Nichts ist, wie es scheint“. Über Verschwörungstheorien, Berlin: Suhrkamp Verlag.
- Pia Lamberty und Katharina Nocun (2020). Fake Facts. Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen, Köln: Bastei Lübbe.
- Andreas Petrik. Corona-Verschwörungstheorien im Faktencheck. Entwurf einer wissenschaftspropädeutischen Problemstudie, auf: Der Didaktische Koffer. Unterrichtsmaterialien für das Fach Sozialkunde, URL: https://www.zsb.uni-halle.de/download/didaktischer-koffer/unterrichtsreihen/corona-verschwoerungstheorien/ (Zuletzt aufgerufen: 8.12.2021).
- Karl R. Popper (1945/1992). Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Band II: Falsche Propheten. Hegel, Marx und die Folgen, 7. überarbeitete Auflage (1992), Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
Zum Weiterschauen und -hören
Die Politikstunde – Warum gibt es gerade so viele Verschwörungstheorien?
Auf das Buch des Amerikanisten Michael Butter, „Nichts ist, wie es scheint“. Über Verschwörungstheorien (Berlin 2018), habe ich mehrfach in diesem Beitrag Bezug genommen. In der „Politikstunde“ der Bundeszentrale für politische Bildung, die sich an Schülerinnen und Schüler richtet, kommt er zu Wort. Im Interview erklärt er das Phänomen und gibt Beispiele. Du findest das Video hier (Link zur Seite der BpB).
Die „Wahrheit“ in Zeiten von Corona (Podcastserie)
Die Bundeszentrale für politische Bildung hat während der „Corona-Krise“ die Podcast-Serie Die „Wahrheit“ in Zeiten von Corona. Verschwörungstheorien und Mythen rund um das Virus herausgegeben. Sie wird von dem Journalisten Axel Schröder moderiert und umfasst bislang vier Folgen (Stand: 24.06.2020). Interessant für uns Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer ist z. B. die vierte Folge mit dem Titel „Corona und ‚Widerstand'“.
Hier geht es vor allem um die Wahrnehmung von Protestierenden, dass es sich mit Demonstrationen während der „Corona-Krise“ um „Widerstand“ handelte. Besonders interessant für dich könnten die Ausführungen von Hedwig Richter, Geschichtsprofessorin, sein. Sie spricht über autoritäre Maßnahmen in einer demokratischen Gesellschaft und erläutert historische Bezüge in Verschwörungserzählungen oder Äußerungen auf Demonstrationen während der „Corona-Krise“.
Du findest die Podcast-Folgen sowie eine Übersicht dazu hier (Link zur Seite der Bundeszentrale für politische Bildung).
Folge im Podcast | Geschichte 21: Umgang mit Verschwörungstheorien
Eine leicht modifizierte und ergänzte Hörversion dieses Beitrages findest du hier als Folge des Podcasts | Geschichte 21: Umgang mit Verschwörungstheorien – oder im Podcatcher deiner Wahl!


